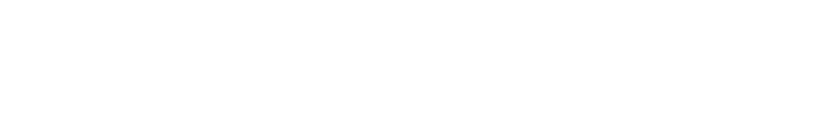Was machten Sie dann?
Ich bin dann ganz langsam an den BMW getreten, habe mich vorgestellt, Rösner meine Visitenkarte gegeben und ihn gefragt, ob man mit ihm reden könne. Zu meiner Verblüffung hatte der überhaupt nichts dagegen. Dem schien sogar zu gefallen, interviewt zu werden.

Röbel (im Schiebefenster zu sehen) spricht mit Hans-Jürgen Rösner.
Und was fragt man einen Geiselgangster in solch einer Situation?
Im Nachhinein betrachtet viel Schwachsinniges. Wie es geht, was man jetzt vorhat und auch, ob man vielleicht etwas für sie tun kann. Uns Journalisten wurde später zu Recht vorgeworfen, dass wir die Gangster regelrecht hofiert hätten. Für die Geiseln muss es furchtbar gewesen sein, das mitanzuhören. Das war ja alles bizarr. Genauso bizarr, wie sich heute die Wortlautprotokolle der Gespräche durchzulesen, die der Verhandlungsführer der Polizei mit Rösner in der Bank geführt hat.
+++ Das Wortlautprotokoll aus der Bank
Haben Sie im Nachhinein gedacht, man hätte mit den Gangstern über andere Themen reden müssen?
Mit einem zu allem entschlossenen Gewaltverbrecher, der ständig mit seiner Pistole herumfuchtelt, über Moral und Ethik seines Handelns zu sprechen, ging auch nicht. Schon bei der leisesten Frage, ob es denn nicht besser wäre, jetzt endlich aufzugeben, bevor noch Schlimmeres passiert, tickte Rösner aus. Da hält man dann lieber den Mund.
Sie wurden dann selbst zum Akteur.
Ja. Irgendwann erwachte in dem Reporter Röbel auch wieder der Mensch Röbel, der die Todesangst im Gesicht von Silke Bischoff sah. Von da an überlegte ich nur noch, wie man sie und ihre Freundin Ines Voitle aus dieser unerträglichen Situation erlösen könnte. Mehr als einmal habe ich sogar daran gedacht, mir einfach die Waffe zu schnappen, die keine 30 Zentimeter vor mir auf dem Schoß von Rösner lag. Warum sind denn keine Polizisten hier, die das tun könnten, fragte ich mich immer wieder. Erst hinterher habe ich erfahren, dass sich unter die Journalisten inzwischen auch SEK-Leute gemischt hatten.
Wie sah Ihre Lösung für die verfahrene Situation in dem Moment aus?
Ich fragte Rösner, ob er eine Austauschgeisel akzeptieren würde. Rösner sagte sofort Ja und fragt mich, an wen ich denken würde. Mir fiel spontan der Bischof von Essen ein. Franz Hengsbach hatte Jahre zuvor das Lösegeld für den entführten Aldi-Milliardär Theo Albrecht übergeben. Rösner willigte ein, ich schickte meine Leute hoch in die Redaktion, um die Polizei über diesen Vorschlag zu informieren. Die versprach, sich wieder bei uns zu melden. Doch dazu kam es nicht mehr. Plötzlich begann sich die Situation dramatisch zuzuspitzen.
Wie sah das konkret aus?
Das Auto war inzwischen umringt von mehreren Hundert Menschen. Nicht nur von Journalisten, sondern auch von vielen Schaulustigen, die schon fast auf der Kühlerhaube saßen. Rösner war plötzlich das Sichtfeld versperrt. Er hielt deshalb seinen Colt aus dem Fenster und forderte die Menge auf, zur Seite zu gehen. Doch die wich keinen Meter zurück. Erst als er – die Waffe mit beiden Händen im Anschlag – wutentbrannt aus dem Auto stieg und „Weg da! Weg da, aber schnell!“ brüllte, tat sich wieder eine Gasse auf. Für einen Augenblick schien sich die Situation wieder zu entspannen. Doch dann sah Rösner, dass er in einer Falle saß: Wer auch immer hatte im Schutz der Menschenmenge die Poller der Fußgängerzone hochgezogen. Der Fluchtweg für die Geiselgangster war damit versperrt.
Und was passierte jetzt?
Das war der Moment, in dem ich endgültig zum Mitbeteiligten an diesem Drama wurde. Plötzlich war ich für Rösner der „Macker“, der ihnen wieder hier raushelfen sollte. Plötzlich hatte ich selbst Verantwortung für die Situation – und damit auch für das Leben der Geiseln. „Sorg dafür, dass die Poller runterkommen“, herrschte Rösner mich an. „Sorg dafür, dass wir hier raus können! Sonst kann ich für nichts mehr garantieren! Wir müssen sofort weg hier! Der Degowski dreht gleich durch!“ Ich bin der Aufforderung dann nachgekommen. Habe immer wieder gerufen, dass die Poller runter müssten, und versucht, die Menge auf Abstand zu halten. Als die Poller dann endlich wieder unten waren, war ich vollgepumpt mit Adrenalin. Und in diesem Moment fragt mich Rösner dann auch noch, ob ich ihnen den Weg zur nächsten Autobahnauffahrt zeigen könne.
Und dann sind Sie ohne zu zweifeln eingestiegen?
Ja. Ich glaube, ich habe keine Sekunde gezögert. Aber ich war so im Tunnel, dass mir nur ein Umweg zur Autobahn eingefallen ist. Durch die ganze Innenstadt über die Zoobrücke.
Hatten Sie denn keine Angst, dass Sie jetzt selbst zur Geisel werden?
Komischerweise nicht. Rösner wollte von mir zwar noch zur nächsten Autobahntankstelle gelotst werden, hatte mir aber versprochen, mich dort wieder rauszulassen. Für mich war das so eine Art Ganovenehrenwort. Und daran hat er sich ja dann auch gehalten.
Was geschah auf der Fahrt?
Kaum noch etwas. Ich saß wie in einem Film auf der Rückbank neben Silke Bischoff, hörte meinen Namen in den Radionachrichten und versuchte herauszufinden, was die Gangster jetzt vorhatten. Als ich Rösner aber direkt fragte, wohin sie denn jetzt fahren wollten, zischte mich Degowski an: „Halt’s Maul, du Affe!“ Da war mir klar, dass ich jetzt wohl besser nichts mehr frage.
An der Raststätte Siegburg hat Sie Rösner dann rausgelassen.
Ja. Er tankte den BMW auf, begleitete die Geiseln zur Toilette und gab mir die Hand, bevor er sich wieder ans Steuer setzte. „Jo, dann“, sagte er zu mir. „Dann noch alles Gute, ne!“ Wenig später stoppte dann das erste SEK-Auto mit der Einsatzleitung darin an der Tankstelle. Die fragten mich nur kurz, ob sich an der Sitzordnung im Geiselauto etwas geändert hätte, und nahmen sofort wieder die Verfolgung auf. Kaum waren sie weg, kam auch schon Ulrich Deppendorf von den ARD-„Tagesthemen“ mit seinem Kamerateam und hielt mir sein Mikrofon unter die Nase. Das war der Moment, als meine Knie weich wurden und ich anfing, am ganzen Körper zu zittern.
Haben Sie im Nachhinein eine Erklärung dafür, warum die Medienmeute im Gladbecker Fall so unkontrolliert agierte?
Es waren insgesamt damals medial andere Zeiten. Den Begriff „political correctness“ kannten wir damals gar nicht. Und wenn einer wegen Mordes verhaftet wurde, nannte man ihn Mörder und nicht mutmaßlichen Mörder. Es war rauer. So nah dran zu sein am Geschehen wie möglich war für uns Normalität. Meine Kollegen und ich sind journalistisch ganz anders sozialisiert worden als die Kollegen von heute. Wir hatten schon vor Gladbeck ganz andere Bilder im Kopf. Schreckliche Bilder – aber für uns selbstverständliche Bilder.
Welche Bilder meinen Sie?
Ich denke an den ersten „finalen Rettungsschuss“ in der Nachkriegsgeschichte der deutschen Polizei 1974 in Hamburg-St. Georg, als die Polizei vor laufender Kamera einem kolumbianischen Bankräuber in den Kopf schoss. Schreckliche Bilder. Die Festnahme der RAF-Terroristen Baader, Raspe und Holger Meins in einer Garage in Frankfurt zum Beispiel. Über Stunden hat das Fernsehen damals live und aus nächster Nähe übertragen, wie die sich einen Schusswechsel mit der Polizei lieferten und wie sie schließlich rausgezerrt wurden aus ihrem Versteck. Der angeschossene Baader, der vor Wut und Schmerzen in die Kamera brüllte, der bis auf die Knochen abgemagerte Holger Meins, nur noch mit seiner Unterhose bekleidet. Der Kameramann hat damals ein Vermögen gemacht mit dem weltweiten Weiterverkauf seiner Filme. Heute hätte bei Twitter wahrscheinlich sofort ein Shit-Storm eingesetzt, weil die Medien die Intimsphäre von Meins verletzt haben. Aber die sozialen Medien in ihrer vielfältigen Wirkung, die auch ein Korrektiv sein können, gab es damals noch nicht. Also haben die Reporter der Achtzigerjahre ihre Arbeit gar nicht so hinterfragen müssen. Das ist heute völlig anders. Die Beobachtung ist viel größer geworden.
Also ist die größere Sensibilität in Ihren Augen ein Fortschritt?
Sie ist zweischneidig, denn natürlich gibt es auch eine Kehrseite. Denken Sie an die Bilder des vietnamesischen Mädchens Kim Phuk, das in den Siebzigerjahren in Vietnam fotografiert wurde, wie es splitternackt einem Napalmangriff der USA davonlief. Und, noch brutaler: das Foto, wie der Polizeichef von Saigon vor laufender Kamera einem gefangenen Vietcong eine Kugel in den Kopf jagt. Würden die Medien heute solche Bilder überhaupt noch zeigen? Oder sie vorher erst einmal technisch bearbeiten, um sie erträglicher für ihr Publikum zu machen? Die Fotos sind auch heute kaum auszuhalten. Aber sie hatten damals solche öffentlichkeitswirksame Macht, dass die US-Regierung schließlich gezwungen war, ihren Kriegskurs zu ändern.
Sie wurden später Chefredakteur der „Bild“-Zeitung. Hat Gladbeck Ihre Arbeit beeinflusst?
Ich war sicher auch als „Bild“-Chef nicht zimperlich. Aber ich habe mich in einem neuen, auch vom Deutschen Presserat nach Gladbeck gesetzten Rahmen bewegt. Meine Reporter habe ich eher zurückgepfiffen, als sie zum Äußersten zu treiben. Und so manches „kritische“ Foto habe ich schwärzen lassen oder erst gar nicht gedruckt. Das war für mich auch eine Lehre aus Gladbeck.